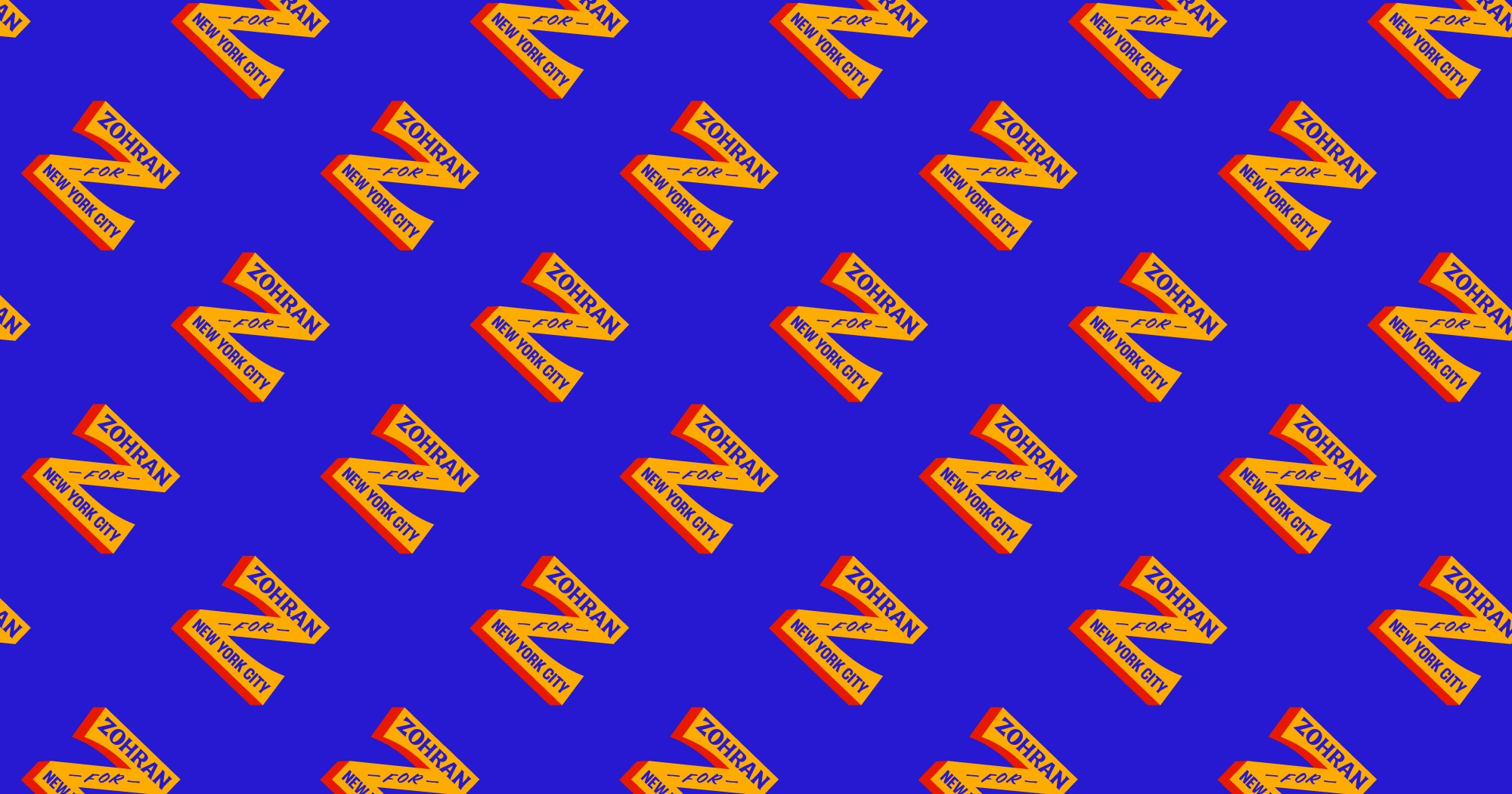Mamdanis Kandidatur kam zum richtigen Zeitpunkt, und er traf mit Andrew Cuomo auf einen überaus unbeliebten Gegenkandidaten. Doch er machte auch sehr viel richtig: Vom politischen Messaging über den Umgang mit sozialen Medien bis zum Einsatz digitaler Tools beschritt seine Kampagne neue Wege. Drei Feinis mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten ordnen ein und beantworten die Frage, was sich von Mamdanis Wahlkampf für zukünftige Kampagnen lernen lässt.
Bürgernähe, Kaufkraft und Diversität
Isabelle Bamert, Kommunikations- und Strategieberaterin: «Mamdani inszenierte sich im Wahlkampf konsequent als bürgernaher Anti-Establishment-Politiker, der mit allen – wirklich mit allen – spricht und ihre Sorgen versteht. Inhaltlich setzte seine Kampagne vor allem auf Kaufkraft-Themen. Sein Hauptslogan ‹For a New York you can afford› könnte auch in vielen Schweizer Städten funktionieren – konkret forderte er unter anderem kostenlose Kitas und ein Einfrieren gewisser Mieten.
Interessant war auch Mamdanis Umgang mit möglichen Vorbehalten gegenüber seiner Religion und seinen migrantischen Wurzeln. Er framte Einwanderung und Religionsvielfalt als etwas Positives und zeichnete das Bild einer Einwanderer-Stadt, die stolz auf ihre Vielfalt ist. Ich vermute, dass sein Team monatelang Rabbis und Pfarrer bearbeitet hat, gemeinsam mit Mamdani aufzutreten. Durch diese überkonfessionellen Auftritte dürfte er für Gläubige anderer Religionen deutlich wählbarer geworden sein.»
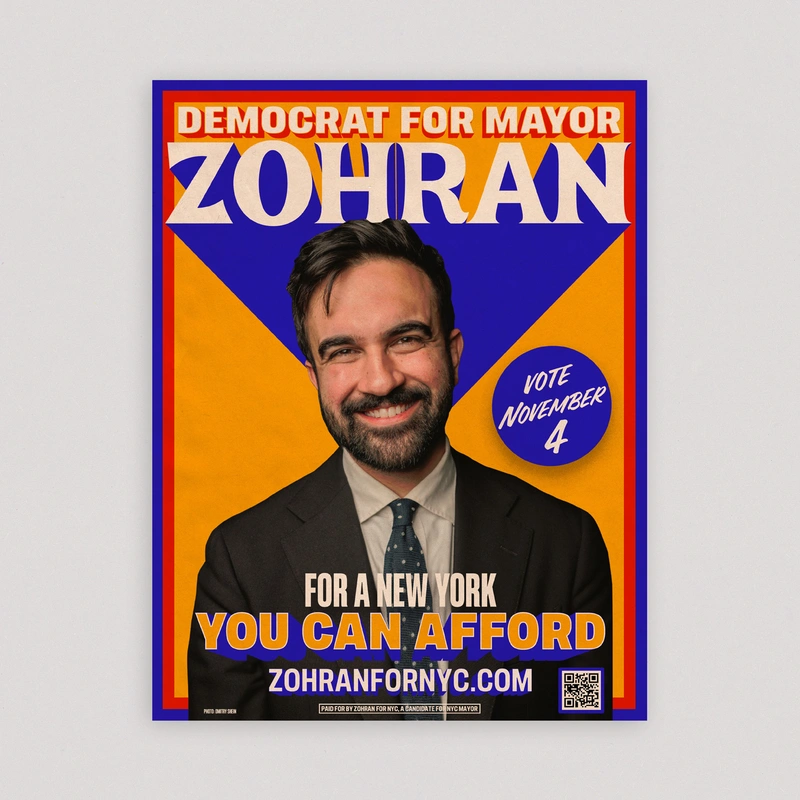

Ein Branding, das «Menschlichkeit» ruft
Carmen Schoder, Kreativstrategien: «Social Media war der zentrale Fokus von Mamdanis Kampagnenstrategie – mehr als bei jeder politischen Kampagne zuvor. Das Besondere daran: Seine Kampagnenstrategie war eine eigentliche Branding-Strategie. Mandani trat in etablierten Social-Media-Formaten wie ‹Subway Takes›, ‹Gaydar Show› oder ‹Trackstar› auf – in Formaten also, die New Yorker:innen ohnehin schon kannten und schauten. Ungeskriptet, ungefiltert, in kurzen und unterhaltsamen Videos mit starkem kulturellen Bezug. Genau das tun erfolgreiche Marken auch: Sie treten dort in Erscheinung, wo sich ihre Zielgruppe bereits aufhält.
Teil dieser Strategie waren auch Mamdanis Offline-Auftritte. Er besuchte Konzerte (z.B. von PinkPantheress), lokale Clubs oder ein Altersheim. Dabei galt seine Präsenz nicht nur den Menschen vor Ort; er und sein Team wussten, dass die Leute ihr Handy zücken würden. Und die Menschen filmten ihn nicht nur, sondern posteten ihn auch in ihren eigenen Accounts – und verwandelten Mamdani so in ein kulturelles Phänomen. Er wurde als «Internet's Boyfriend» bezeichnet, und es entwickelte sich eine Fan-Dynamik mit Supportern, die eigenen Content entwickelten. Das Audio ‹The name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I› – ein Auszug aus einer Debatte mit Cuomo, der Mamdanis Name ständig falsch aussprach und dessen Korrektur durch Mamdani selbst dann auf einen Gwen-Stefani-Song gelegt wurde – wurde zum Soundtrack der Bewegung. Mamdanis Kampagne wich der Eigendynamik des Internets nicht aus, sondern wusste sie geschickt für sich zu nutzen.
Der visuelle Auftritt der Kampagne ruft ‹Menschlichkeit› und passt zu Mamdanis gesamter Positionierung wie die Faust aufs Auge: Die handgezeichnete Font mit den sympathischen Serifen schafft eine Menschlichkeit und Nähe, die eine kühle Grotestk-Schrift nie hinkriegt. Als demokratischer Kandidat nutzt er selbstverständlich das Blau, grenzt sich durch den Fokus auf die Komplementärfarbe Orange aber auch klar vom demokratischen Mainstream ab. Die Farben seiner Videos sind warm und weich; die Szenen sind oft aus der Hand gefilmt mit viel Bewegung; er ist häufig leicht off-center im Frame, rückt sich also nicht permanent ins Zentrum. Schnelle Schnitte, viel Bewegung – die kurze Aufmerksamkeitsspanne wird perfekt bespielt.
Ingesamt zeigt Mamdanis Wahlkampf, dass sich politische Kampagnen heute nicht mehr nur um Parteiprogramme und Versprechungen drehen. Politische Inhalte bleiben natürlich wichtig und sind immer noch der Kern der Sache. Aber Kandidierende müssen erkennen, wie wichtig es angesichts des veränderten Mediennutzungsverhaltens ist, Teil der ‹digitalen Gesellschaft› zu sein. Politische Kampagnen müssen algorithmusfreundlicher werden, auch in der Schweiz. Langatmige Werbespots mit geskripteten ‹Wähl mich›-Slogans funktionieren nicht mehr.»
Per Chatbot in die DMs
Moritz Friess, Digitalstratege: «Spannend war auch der Einsatz von Automatisierung in der Kampagne. Ein Chatbot reagierte auf Kommentare, Direktnachrichten und Story-Erwähnungen. Wer ein bestimmtes Stichwort kommentierte oder Mamdanis Account markierte, erhielt prompt eine persönliche Nachricht (DM) mit weiterführenden Links zu Spenden, Petitionen oder Volunteering-Gelegenheiten. Das Entscheidende dabei: Es handelte sich um persönliche Nachrichten, nicht um öffentliche Antworten. Damit wurde die Interaktion sofort auf ein 1:1-Level gehoben – ein Ansatz, den auch die Forschung über Hate Speech als besonders wirkungsvoll beschreibt.
Zum Einsatz kam dabei offenbar das Tool Manychat. Die Lösung war aus mehreren Gründen clever: Die Lead-Generierung war in das Medium eingebettet, in dem sich die Zielgruppen bereits aufhielten. Interessierte konnten ihre E-Mail-Adresse einfach per DM senden, woraufhin der Bot diese ins Kampagnen-CRM einspeiste. Damit wurde ein Weg gefunden, Absprünge durch Medienbrüche zu minimieren. Die eigene Adresse per DM zu senden, fühlt sich offenbar natürlicher an, als ein Formular auf einer Webseite oder ein Lead-Ad-Formular auf Instagram auszufüllen. Ein weiterer Vorteil: Da die Interaktionen von den Nutzern selbst ausgelöst wurden, wirkte die Ansprache weniger aufdringlich. Und weil sich das ganze in den DMs abspielte, konnten Algorithmen umgangen werden, die Instagram-Posts mit externen Links normalerweise abstrafen.
Die Kampagne setzte KI äusserst geschickt ein – und nie an Stellen, wo sie der Kampagne das Nahbare genommen hätte, beispielsweise durch KI-generierte Bilder. Eine Direktnachricht wird im ersten Moment vielleicht sogar als besonders persönlich wahrgenommen, selbst wenn sie von einem Bot kommt, eben weil es sich um eine persönliche Nachricht handelt.»

Nerden mit Moritz über digitale Strategien.

Café mit Carmen über Content.